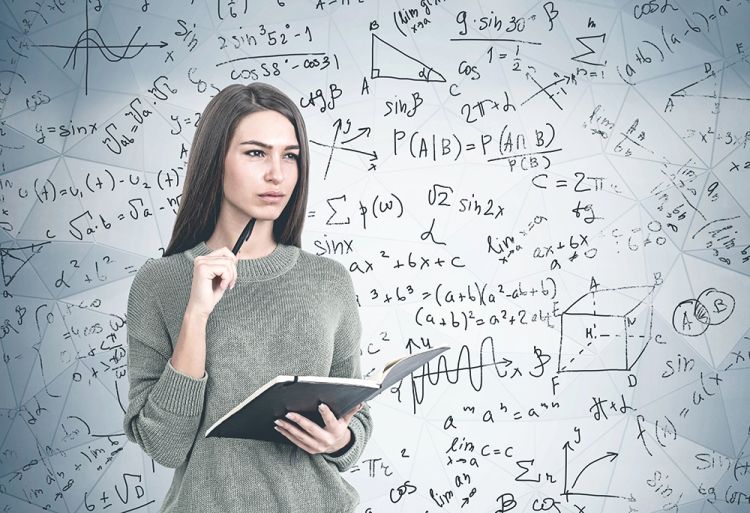Im Sommer 2024 traten rund 2800 ICT-Lernende zur Lehrabschlussprüfung an, um ihre Grundbildung mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abzuschliessen. Laut dem Verband ICT Berufsbildung Schweiz sind das leider bei weitem nicht genug: Bis 2030, so der Verband, müssten knapp 40’000 zusätzliche ICT-Fachkräfte ausgebildet werden, um den aktuellen Bedarf zu decken.
Total braucht die Branche bis 2030 sogar knapp 120’000 zusätzliche Personen, wie das Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB) im Bericht «ICT-Fachkräftesituation: Bedarfsprognose 2030» vorrechnet (ICT-Brutto-Fachkräftebedarf). Absolut zentral für den Fachkräfte-Nachschub ist in der Schweiz das historisch enorm erfolgreiche duale Bildungssystem – sprich die Berufslehre.
Auf den ersten Blick fordert die Branche laut dem IWSB sehr viele studierte Fachleute (ca. 35 %). Dies widerspricht der Förderung der Berufslehre respektive ICT-Grundbildung jedoch nicht – das Gegenteil ist gar der Fall: Etwa die Hälfte der ICT-Lehrabgänger machen innerhalb von nur fünf Jahren eine tertiäre Ausbildung, weitere 9 Prozent absolvieren eine Berufsmatura nach der Lehre, legen also zumindest die Basis für ein Hochschulstudium. Alles in allem stellt die Studie fest: knapp 80 Prozent aller ICT-Abschlüsse haben ihren Ursprung in der ICT-Berufslehre.
Die Förderung der ICT-Berufslehre ist damit wohl alternativlos, um den Bedarf zu decken. Laut der IWSB-Studie noch ein langer Weg: Die Lehrstellenquote – sprich das Verhältnis von ICT-Lehrverträgen zu ICT-Vollzeitstellen – von knapp 6 Prozent (Stand Sommer 2022) müsste auf mehr als 8 Prozent steigen, um die genannte Zahl an neuen Fachkräften auszubilden.
Brachliegendes Potenzial
Von 2022 auf 2023 konnte die Zahl der ICT-Lehrverträge um 5 Prozent erhöht werden. Das sei zwar erfreulich, so der Verband, ausgeschöpft sei das Potenzial damit aber noch nicht.
Spannendes Detail: Vor allem viele KMU sind die Vorreiter in Sachen ICT-Lehrstellen und nehmen laut dem Verband eine wichtige Rolle in der Schaffung von Lehrstellen ein.
Aus Expertenkreisen hört man aber immer wieder, dass es besonders in internationalen Firmen, die unser Bildungssystem nicht in ihrer DNA tragen, Hürden gibt, Sinn und Wert von Lehrstellen in die Köpfe des Managements zu bringen. So haben AWS und Google in der Schweiz beispielsweise zwar Lehrstellen geschaffen und engagieren sich in der Nachwuchsförderung – die Lehrstellenquote liegt aber nach wie vor weit unter dem genannten und ohnehin immer noch zu tiefen Branchendurchschnitt.
Das Problem Frauenquote
Ein weiterer Ort, wo man einen Hebel ansetzen kann, ist beim Frauenanteil in der ICT-Lehre – denn dieser ist mit knapp 15 Prozent nach wie vor recht tief. Bei den Berufslehren Informatiker/in EFZ und ICT-Fachfrau/-mann EFZ liegt die Quote unter 10 Prozent, bei den Gebäudeinformatikerinnen und -informatiker sind es gerade einmal 2 Prozent.
Die Mediamatik ist mit einem Frauenanteil von gut 40 Prozent der erfreuliche Ausreisser und mit der seit 2023 etablierten Berufslehre Entwickler/in digitales Business EFZ (siehe Seite 32) ist man ebenfalls auf einem guten Weg: Hier beträgt die Frauenquote doch immerhin rund 26 Prozent. Beim Begeistern von Frauen für ICT-Berufe gibt’s also noch Luft nach oben. Es bleibt zu hoffen, dass entsprechende Awareness- und Motivations-Kampagnen, wie die 2024 lancierte Woman-in-Tech-Initiative von ICT Berufsbildung Schweiz, Früchte tragen.
Hohe Zufriedenheit
ICT-Berufe sind bezüglich Lohnniveau, Jobsicherheit und vielseitigen Tätigeitsfeldern sowie spannenden Karrierepfaden attrakiv. Und das spiegelt sich in der Zufriedenheit der Lernenden wider: Laut einer Befragung des Verbands sind 94 Prozent der ICT-Lernenden zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Wahl, nur 5 Prozent würden nicht nochmal eine ICT-Lehre wählen.
Wichtig ist auch, dass der eingangs erwähnte Wille zur Weiterbildung nicht abreisst: Mehr als die Hälfte der Lernenden will zwei bis drei Jahre nach der Lehre in die Fachhochschule, ein Drittel an die höhere Fachschule und 12 Prozent haben einen eidgenössischen Fachausweis oder ein Diplom im Blick.
In der Folge zeigen wir die fünf ICT-Berufslehren mit ihren verschiedenen Fachrichtungen, Lerninhalten und Anforderungen auf. Wichtig anzumerken ist, dass es für angehende Lernende verschiedene Ansätze gibt, um zum EFZ zu kommen. Neben der regulären dualen Berufslehre im Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule gibt es etwa ein Modell mit einem Basislehrjahr in einem Ausbildungszentrum sowie die schulisch organisierte Grundbildung (SOG) oder die Informatikmittelschule.
Informatiker/in EFZ
Die Lehre als Informatiker/in EFZ gibt es in den zwei Fachrichtungen Applikations- und Plattformentwicklung. Voraussetzungen sind hier wie dort analytisches Denken, hohes Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und die Freude an Digitaltrends.Die vierjährige Berufslehre als Informatikerin oder Informatiker mit Eidgenössischen Fachzeugnis (EZF) gibt es in zwei Fachrichtungen: Applikationsentwicklung und Plattformentwicklung (ehem. Systemtechnik und Betriebsinformatik). Die entsprechende Spezialisierung beginnt zu Beginn des zweiten Lehrjahres.
In beiden Fachrichtungen besuchen Lernende während zwei Tagen pro Woche die Berufsfachschule und verbringen in der Regel den Rest der Woche im Lehrbetrieb. Vertieftes Wissen in Themen wie IoT, Machine Learning, Public Cloud, Mobile Apps oder vertiefte Datenanalyse, die nicht zwingend im Alltag des Lehrbetriebs vorzufinden sind, werden im Rahmen von überbetrieblichen Kursen (üK) vermittelt. Die Kurse beanspruchen 35 Tage und verteilen sich auf mehrere Lehrjahre. Während ein Teil der Kurse obligatorisch ist, können gewisse üK-Themen nach Bedarf des Lehrbetriebes oder aufgrund persönlicher Interessen der Lernenden ausgewählt werden.
Lernende in der Fachrichtung Applikationsentwicklung sollen nach dem Abschluss primär als Software-Entwicklerinnen und -Entwickler für Anwendungen, Mobile Apps und Websites in unterschiedlichen Bereichen arbeiten können. Neben der reinen Developer-Kompetenz, die während der Berufslehre vermittelt wird, werden die Lernenden während der Ausbildung auch in verwandte Themen eingearbeitet – beispielsweise Software-Testing, die Konzeption von Software-Architektur und der enge Austausch mit verschiedenen Stakeholdern (bspw. Kunden, Nutzer, Abteilungen innerhalb des Unternehmens).
Die Fachrichtung Plattformentwicklung beschäftigt sich derweil vor allem mit dem Betrieb von IT-Umgebungen und den damit einhergehenden Security-Themen. Im Fokus stehen unter anderem Cloud-Infrastrukturen und -Services sowie lokale Infrastruktur in IT-Abteilungen und bei Kunden. Plattformentwickler kümmern sich damit etwa um Life Cycles der Infrastruktur, der Virtualisierung von Cloud-Lösungen, Netzwerksicherheit und -architektur sowie vielen anderen für den IT-Betrieb relevanten Themenfeldern. Gemeinsam haben die beiden Fachrichtungen derweil Themen wie Innovation, Analyse, Projektmanagement und Security.
Empfehlenswerte Voraussetzungen für den Einstieg als Informatikerin oder Informatiker EFZ sind eine gute Analysefähigkeit, das Interesse für aktuelle Digital-Trends, Teamfähigkeit und aufgrund der Handhabung von Security-relevanten Unternehmensdaten ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Weiter helfen gute Vorkenntnisse respektive ein gewisses Talent in Mathematik, Englisch und Deutsch.
Die Berufslehre in Kürze
Dauer: 4 Jahre
Schwerpunkte Vertiefung Applikationsentwicklung
• Software & Programmierung
• Applikationen (PC, Mobile, Web)
• Datenbanken
Schwerpunkte Vertiefung Plattformentwicklung
• Cloud-Infrastruktur & -Services
• Server, Netzwerk & Infrastruktur
Voraussetzungen
• Analytisches Denken
• Hohes Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit
• Interesse an Digital-Trends
ICT-Fachmann/-frau EFZ
Als praxisorientierte Allrounder sind ICT-Fachmänner und -Fachfrauen für die Installation, die Wartung und den Support aller erdenklichen IT-Mittel in verschiedenen Organisationen und bei den Kunden ihres Arbeitgebers zuständig.Während oft die Rede vom Mangel an hochspezialisierten IT-Fachleuten ist, ist die Realität aber: Ohne breiter abgestützte Support-Fachleute, die dank einer gewissen Sozialkompetenz auch weniger geschulte Nutzerinnen und Nutzer abholen können, würde in der IT nichts gehen. Hier kommt die Berufslehre als ICT-Fachmann / ICT-Fachfrau EFZ ins Spiel.
Ausgelernte ICT-Fachmänner und -Fachfrauen sind die praxisorientierten Allrounder unter den IT-Lernenden. Die Ausbildung, die im Gegensatz zur Informatiker-Lehre nur drei statt vier Jahre dauert, fokussiert sich massgeblich auf die praktische Installation und Anwendung von IT-Mitteln sowie dem Support rund um alle möglichen IT-Themen. Auf dem Lehrplan stehen etwa das Aufsetzen, die Inbetriebnahme und die Wartung von Unternehmensnetzwerken, Serverdiensten, Rechnern und Peripheriegeräten.
In den überbetrieblichen Kursen und der Berufsschule erfahren die Lernenden etwa, wie Netzwerke, Server und Betriebssysteme aufgesetzt, konfiguriert und administriert werden oder wie die Funktion von Endgeräten in der Unternehmensnetzwerkinfrastruktur gewährleistet wird. Weitere Themenblöcke drehen sich um die Arbeit im 1st- und 2nd-Level-Support, Security oder der Automatisierung von Prozessen mithilfe von Scriptsprachen.
Besonders ins Zentrum gerückt wird im Rahmen der Ausbildung auch das Thema Kommunikation. Durch die enge Zusammenarbeit mit Endnutzern sollte bei den Lernenden der Wille vorhanden sein, sich mit diesen auseinanderzusetzen, sie bei der Inbetriebnahme und Nutzung verschiedener Hard- und Software zu unterstützen und gegebenenfalls Anleitungen und Checklisten für die Nutzer zur Verfügung stellen zu können. Je nach Art des Lehrbetriebes respektive des Arbeitgebers nach der Ausbildung haben ICT-Fachmänner und -frauen in vielen beruflichen Situationen mit verschiedensten Kunden, Spezialisten aber auch über alle Führungsstufen hinweg direkten Kontakt. Damit sind auch eine hohe Sozialkompetenz und gute Umgangsformen, aber durch den Kontakt mit vertraulichen Informationen auch hohe Vertraulichkeit beste Voraussetzungen.
Im Gegensatz zur Informatiker-Lehre dauert die Ausbildung als ICT-Fachmann / ICT-Fachfrau EFZ nur drei statt vier Jahre. Die Ausbildung befindet sich derzeit in der obligatorischen, alle fünf Jahre wiederkehrenden Revision durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Hierbei wird der Lehrgang auf seine Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Inkraftsetzung der revidierten Bildungsdokumente ist auf Januar 2026 geplant.
Die Berufslehre in Kürze
Dauer: 3 Jahre
Schwerpunkte
• Inbetriebnahme und Wartung von Netzwerken, Endgeräten, Servern, Peripherie und Services
• 1st- und 2nd-Level-Support
• Zusammenarbeit mit Spezialisten, Endnutzern und Abteilungen
• Mitarbeit im Bestellwesen, Beschaffung und Administration
Voraussetzungen
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Hohe Vertraulichkeit
• Vernetztes Denken
• Technisches Geschick
Mediamatiker/in EFZ
In der Berufslehre als Mediamatiker/in EFZ werden zahlreiche Gestaltungs- und IT-Skills vermittelt und verknüpft. Aber auch betriebswirtschaftliche und nicht zuletzt Kommunikationsthemen haben einen hohen Stellenwert.Die vierjährige Berufslehre als Mediamatiker/in EFZ bringt kreatives Schaffen und Kommunikation mit IT-Skills zusammen. Die Lernenden arbeiten in verschiedenen Multimedia-Projekten, etwa in den Bereichen Social Media oder Web Design und in der Erstellung von Bildmaterial, Videos, Texten, Präsentationen und Audiomaterial. Dazu werden nicht zuletzt zahlreiche IT-Werkzeuge wie HTML, CSS, JavaScript, die Adobe Creative Cloud und Datenbanken genutzt.
Dafür arbeiten Mediamatikerinnen und Mediamatiker an zahlreichen Schnittstellen. Je nach Lehrbetrieb und Ausrichtung dessen können das etwa Druckereien, Informatikfirmen, Medien, Verlagshäuser sowie interne und externe Kunden sein. Diese Bildungsinhalte können also durchaus variieren, je nachdem, ob Lernende bei einer Agentur, in der Marketingabteilung eines Grossunternehmens oder in einem kleineren Betrieb ihre Lehre absolvieren. Die Frage, welche Schwerpunkte in einem Lehrbetrieb gesetzt und gefördert werde, sollte bei der Suche nach der passenden Lehrstelle dringend berücksichtigt werden. Ob aus einem Mediamatik-Lernenden nach der Lehre ein Kommunikationsprofi mit ausgeprägten Digitalisierungs-Skills oder ein kompetenter Web-Designer wird, hängt also stark vom Lehrbetrieb und dessen Ausrichtung ab.
Von sechs Kompetenzfeldern müssen vier im Betrieb vertieft vermittelt werden. Diese sind: Marketing und Kommunikation, Multimedia, Gestaltung und Design, Informatik, Administration und Betriebswirtschaft sowie Projektmanagement. Das Kompetenzfeld Projektmanagement ist gesetzt und muss einer der vier vertieften Bereiche sein.
In den überbetrieblichen Kursen und der Berufsschule wird die ganze Breite vermittelt: Hier werden sowohl digitale Skills (bspw. Web-Projekte und Datenbanken) als auch analoge Gestaltung (bspw. Fotografie und Print) vermittelt. Und auch betriebswirtschaftliche Themen wie Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsrechnungen bekommen ihren Platz.
Gefordert wird von den Mediamatik-Lernenden neben dem Interesse an Technologie natürlich ein gewisses kreatives Flair, dank der Vielfalt an Medienformen ist der Fächer dieser Skills aber sehr breit und wie bereits erwähnt auch abhängig vom Lehrbetrieb. Weiter sind ausgeprägte Kommunikations-Skills gefragt, um eine gute Zusammenarbeit mit Kunden, Stakeholdern und anderen Mitarbeitenden zu gewährleisten und Beratungsleistungen erbringen zu können. Ein gewisses sprachliches Talent und wenn möglich gute Kenntnisse in Englisch und einer zweiten Landessprache runden die wichtigsten Voraussetzungen ab.
Die Berufslehre in Kürze
Dauer: 4 Jahre
Schwerpunkte
• Digitale und analoge Gestaltung
• Erstellung und Bewirtschaftung von Websites und Social-Media-Kanälen
• Handhabung von Informatik-Tools für die Erstellung und Gestaltung von Medien
• Betriebswirtschaftliche Themen
• Kommunikation mit Kunden, Partnern, Arbeitskollegen etc.
Voraussetzungen
• Kreative Ader und Organisationstalent
• Freude an Kommunikation und Teamarbeit
• Sprachliches Talent
• Interesse für Technologie und unterschiedliche Kommunikationsmittel
Gebäudeinformatiker/in EFZ
Sie machen Gebäude «smart» und bewegen sich zwischen Gebäudetechnik und Informatik: Die drei Fachrichtungen der Gebäudeinformatik bieten ein breites Themenfeld mit vielfältigen, spannenden Aufgaben.Der Bereich Gebäudeinformatik ist der Ort, an dem sich Gebäudetechnik, Elektroinstallation und Informatik respektive IoT die Hand reichen. Wie die Informatiker-Lehre gibt’s auch hier verschiedene Fachrichtungen, für die sich Lernende entscheiden können. Diese sind die drei Bereiche Gebäudeautomation, Kommunikation und Multimedia sowie Planung. Wie die meisten anderen ICT-Berufslehren dauert auch die Lehre als Gebäudeinformatiker/in EFZ vier Jahre.
In der Fachrichtung Gebäudeautomation liegt der Fokus im Wesentlichen auf der Vernetzung in und von Gebäuden und allen möglichen Gerätschaften, die an solchen Netzwerken hängen. Das umfasst etwa Systeme wie Heizung, Lüftung, Licht, Haushaltsgeräte, aber auch sicherheitsrelevante Elemente wie Systeme für die Brand- oder Einbruchsicherung zählen zum Verantwortungsbereich der Fachrichtung. Zentral sind dabei die Einrichtung von Netzwerkinfrastrukturen in Gebäuden, das Aufsetzen und Pflegen von Haussteuerungen und die Implementierung zahlreicher Elemente für die Gebäudeautomation wie etwa Licht- oder Klimasysteme.
Wenn es hingegen mehr um die Vernetzung verschiedener Kommunikationsmittel und Multimedia-Systeme in Gebäuden aller Art geht, kommt die Fachrichtung Kommunikation und Multimedia ins Spiel. Lernende konzentrieren sich hier etwa auf die Integration und Wartung von Hard- und Software für IP-Telefonie und von Multimedia-Endgeräten wie TVs, Audiosystemen, PCs, oder mobilen Geräten in Gebäudenetzwerken. Der Lehrplan für Berufsschule und Kurse bietet neben den genannten Bereichen auch Einblick in angrenzende Themen wie Cloud- und IoT-Services oder den Schutz und die Optimierung von Netzwerken.
In der dritten Fachrichtung, der Planung, geht es um die Koordination der Systeme in der Gebäudeinformatik. Die Lernenden arbeiten in der Projektierungsphase bei Vorhaben der Gebäudeinformatik und unterstützen die Projektleitung mit sorgfältiger Planung der Systeme und koordinativen Aufgaben in Schnittstellenpositionen. Da die Planer unter den Gebäudeinformatikerinnen und -informatikern selbstverständlich eine gute Übersicht über alle möglichen Elemente in der Gebäudeinformatik haben müssen, gibt’s bei dieser Fachrichtung eine Besonderheit: Im 2. und 3. Lehrjahr absolvieren die Lernenden Praktika in den anderen beiden Gebäudeinformatik-Bereichen.
Die Anforderungen für die Lehre als Gebäudeinformatiker/in EFZ sind neben dem Interesse an Informatik auch ein Flair für Elektronik und Technik. Weiter sind logisches Denken und für die Projektzusammenarbeit Teamarbeit gefragt. Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und Selbstständigkeit sind ebenfalls hilfreiche Qualitäten.
Die Berufslehre in Kürze
Dauer: 4 Jahre
Schwerpunkte
• Vernetzung von Infrastruktur und Gebäuden
• Planung der Gebäudeinformatik
• Implementierung von Gebäudetechnik-, Kommunikations- und Multimediasystemen
• Prüfung und Sicherung der Netzwerke und Komponenten
Voraussetzungen
• Interesse an Informatik, Elektronik und Technik
• Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Logisches Denken
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
Entwickler/in digitales Business EFZ
Als Digitalisierungs- und Transformationsprofis von morgen lernen Entwickler/innen digitales Business EFZ, wie man Projekte optimiert, neue Technologien evaluiert und einführt und erfolgreich Schnittstellenpositionen einnimmt.Die neueste der fünf ICT-Lehren ist die Ausbildung als Entwickler/in digitales Business EFZ: Im Sommer 2023 haben die ersten 103 Lernenden in der Schweiz diese Berufslehre begonnen – die ersten Entwickler/innen digitales Business EFZ sind zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht einmal ausgelernt. Die Lehre dauert ebenfalls vier Jahre, die ersten Lehrabschlussprüfungen werden also 2027 stattfinden. Die Abgängerinnen und Abgänger sollen in der Lehre zu ausgewiesenen Transformations- und Digitalisierungsprofis ausgebildet werden und werden daher unter anderem in allen möglichen Bereichen der Projektplanung und -arbeit gefördert. Zentral sind damit etwa Themen wie das Verständnis für Geschäftsprozesse, Kommunikation, Datenanalyse und einen grossen Fächer digitaler Lösungen.
In der Praxis arbeiten Entwickler/innen digitales Business EFZ also vor allem in Projekten mit und sind dort etwa für die Analyse und die Optimierung von Prozessen zuständig – natürlich mit den entsprechenden digitalen Werkzeugen. Basierend auf Auswertungen von Prozessen und Daten im Unternehmen sowie deren Visualisierung unterstützen sie etwa die Fachspezialisten im Betrieb oder treiben die Digitalisierung von Organisationen voran. Beispiele sind die koordinative Zusammenarbeit mit Applikationsentwicklerinnen und -entwicklern, die Vereinheitlichung von Tool-Landschaften oder Prozessoptimierungen. Weiter sollen digitale Trends und Innovationen auf dem Radar der Lernenden sein, um die digitale Transformation am Zahn der Zeit vorantreiben zu können.
Ins Zentrum gerückt wird damit auch die Positionierung als Schnittstelle zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen. Kommunikations-Skills werden gefordert und gefördert, da die Lernenden nicht nur mit Projektmitarbeitern, sondern mit einer Fülle an verschiedenen Beteiligten – von Laien bis zu hochspezialisierten Fachleuten – in Kontakt stehen.
Die Themen in der Berufsschule und den überbetrieblichen Kursen sind damit enorm breit angelegt und reichen von der Datenanalyse und -darstellung über alle möglichen Themen rund um Prozesse bis hin zur Kommunikation mit verschiedenen Anspruchsgruppen, auch in mehreren Sprachen. Dazu kommen technische Themen wie beispielsweise die Automatisierung von Prozessen mit Hilfe von Programmiersprachen.
Interessierte sollten vernetzt und analytisch denken können und Organisationstalent mitbringen. Aufgrund ihrer Schnittstellenposition werden dazu gute Kommunikationsfähigkeit und die Freude am Umgang mit allen möglichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen gefragt. Darüber hinaus ist das Interesse für digitale Trends und Entwicklungen natürlich von grosser Relevanz.
(win)
Die Berufslehre in Kürze
Dauer: 4 Jahre
Schwerpunkte
• Projektarbeit und -koordination
• Analyse von Daten und Prozessen
• Einführung digitaler Lösungen
• Schnittstellenfunktion für Fachspezialisten, Kunden, Abteilungen etc.
Voraussetzungen
• Ausgeprägte Kommunikations-Skills und Teamfähigkeit
• Analytisches Denken
• Interesse an aktuellen Trends und Entwicklungen im digitalen Sektor
• Organisationstalent